|
|
Wie viel Mathematik brauchen Studierende der MINT-Fächer?
Öffentliche Podiumsdiskussion
im Rahmen der Jahrestagung der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 2015
in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg
Dienstag, 22. September 2015, 19:30 Uhr
Ernst-Cassirer-Hörsaal (Hörsaal A)
Edmund-Siemers-Allee 1
Lernen für das Leben, oder genauer: Lernen für den Beruf?
MINT steht für Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik und umfasst Fächer wie Biologie,
Chemie, Physik, die Geowissenschaften, die Informatik und
alle Bereiche der Ingenieurwissenschaft. Als Grundlage
der modernen Naturwissenschaften hat Mathematik eine
besondere Rolle für diese Fächer, die an der zentralen Rolle
der Mathematik in den Studienplänen der Studierenden dieser Fächer deutlich wird.
Aber wieviel und welche Art von Mathematik brauchen Studierende der MINT-Fächer
für ihr Leben oder ihren Beruf?
Ohne eine Antwort auf diese Frage ist eine rationale Diskussion über die Frage nach den
mathematischen Kenntnissen, die von Studienanfängern der MINT-Fächer
gefordert werden,
nicht möglich.
Da viele mögliche berufliche Lebensläufe für
MINT-Studierende denkbar sind, darf sich die Diskussion nicht
an Beispielfällen orientieren, sondern sollte von
grundsätzlichen Erwägungen getragen werden.
Dabei müssen die zukünftigen Wissenschaftler, deren Erkenntnisse
unser Land für wirtschaftlichen Erfolg dringend braucht,
ebenso in den Blick genommen werden, wie die Absolventen,
die nur wenig Mathematik in ihrem beruflichen Umfeld
brauchen werden, und deren Studienerfolg möglicherweise durch zu hohe Anforderungen im
Fach Mathematik gefährdet ist.
Dürfen die mathematischen Anforderungen
an MINT-Studierende—im Hinblick auf das föderative
System und die Autonomie der Bundesländer in der Bundesrepublik
Deutschland—vom Bundesland abhängen? Besitzen die Personen,
die Entscheidungen über die Mathematikanforderungen treffen, die
dazu notwendige Kompetenz? Wie kann man sicherstellen, dass
zukünftig in diesen Fragen vernunftgebotene Entscheidungen getroffen werden?
Diese Diskussion muss alle relevanten Parteien einbinden:
die Politik, die Schulmathematik, die Hochschulmathematik und
die Vertreter der MINT-Fächer.
Im Rahmen der Jahrestagung der Deutschen
Mathematiker-Vereinigung (DMV) richtet der Fachbereich Mathematik der Universität Hamburg in Kooperation mit der
Akademie der Wissenschaften in Hamburg
und der gemeinsamen Mathematik-Kommission
Übergang Schule-Hochschule der DMV, der Gesellschaft
für Didaktik der Mathematik (GDM)
und des Deutschen Vereins zur Förderung
des mathematischen und naturwissenschaftlichen
Unterrichts (MNU) eine öffentliche Podiumsdiskussion
zu diesen Fragen aus, zu dem alle
Interessierten ganz herzlich eingeladen sind.
Auf dem Podium diskutieren:

|
Stephan Kabelac, Professor für
Thermodynamik an der Leibniz Universität
Hannover und Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg
|
Matthias Lippert, Schulleiter des Röntgen-Gymnasiums
Remscheid und Mitglied des Präsidiums der Deutschen Mathematiker-Vereinigung
|

| 
|
Volker Bach, Professor für Mathematik an der Technischen Universität Braunschweig
und
Präsident der Deutschen Mathematiker-Vereinigung
|
Ricki Rosendahl, Mathematik-Lehrerin am Gymnasium Corveystrasse in Hamburg-Lokstedt
| 
|
und
Monika Seiffert, Fachreferentin für den Bereich MINT in der
Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) der Freien und Hansestadt Hamburg.
Die Diskussion wird moderiert von
Reiner Lauterbach,
Professor für Mathematik an der Universität
Hamburg und Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
PDF-Version des Flyers:
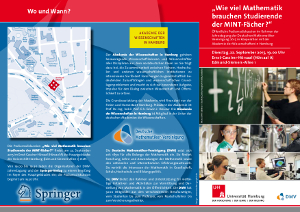
(Design: Katja Stüber)
Von 19:00 bis 19:30 laden die Organisatoren der DMV-Jahrestagung und der
Springer-Verlag zu einem Empfang im Foyer des Hauptgebäudes der Universität
ein; die Podiumsdiskussion beginnt um 19:30 Uhr.

|
|