Programm der Herbsttagung 1999
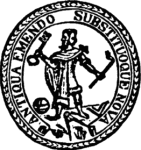
Mathematische Gesellschaft in Hamburg
zusammen mit dem
Fachbereich Mathematik der
Universität Hamburg
Programm der Herbsttagung 1999
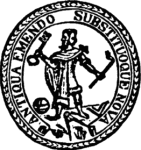
Mathematische Gesellschaft in Hamburg
zusammen mit dem
Fachbereich Mathematik der
Universität Hamburg
Freitag, 5. November 1999, Hörsaal H 1, Geomatikum
| 15.15 - 15.30 Uhr | Begrüßung und Einführung |
| 15.30 - 16.15 Uhr | Manfred Kudlek (Hamburg) |
| Geschichte der Theoretischen Informatik | |
| 16.30 - 17.00 Uhr | Kaffeepause |
| 17.00 - 17.45 Uhr | Sven Heinrich (Hannover) |
| Das Jahr-2000-Problem aus der Sicht eines Rückversicherers | |
| 18.00-18.45 | Simone Fischer-Hübner (Hamburg) |
| Datenschutz durch Technik | |
| ca. 19.30 Uhr | Nachsitzung im Hotel Elysée, Rothenbaumchaussee 10, |
| Raum Hamburg (Anmeldung erforderlich). | |
| Für das Essen wird ein Kostenbeitrag | |
| von DM 40,- pro Person erhoben. |
Sonnabend, 6. November 1999, Hörsaal H 1, Geomatikum
| 9.15 - 10.00 Uhr | Wilfried Brauer (München) |
| Zum Gemeinsamen und Trennenden von Mathematik und Informatik | |
| 10.15 - 11.00 Uhr | Michael Hortmann (Bremen) |
| Kryptografie, Fragen der Zertifizierung, Datensicherheit aus dem aktuellen Stand | |
| 11.15-11.30 Pause | |
| 11.30 - 12.15 Uhr | Monika Seiffert (Hamburg) |
| Kryptologie in der Schule | |
| 14.30 Uhr | Exkursion zum Fachbereich Informatik |
| ``Vorführung aus verschiedenen Forschungsbereichen | |
| (Künstliche Intelligenz; theoretische, technische Informatik)'' |
Es werden Ursprünge der und Einflüsse auf die Theoretische Informatik vorgestellt. Diese kommen aus verschiedenen anderen Disziplinen.
Das Jahr-2000-Problem aus der Sicht eines Rückversicherers
Dr. Sven Heinrich
Allgemein besteht eine große Besorgnis und Unsicherheit über die Auswirkungen des sogenannten Jahr-2000-Problems. Wie die meisten Versicherungsunternehmen hat auch die Hannover Rück-Gruppe hierzu eine Vielzahl von Aktivitäten eingeleitet, die von einem eigenen Projekt koordiniert werden.
In erster Linie betreffen diese Aktivitäten die Überprüfung der vorhandenen technischen Systeme und die Behebung erkannter Probleme mit dem Wechsel von 1999 auf das Jahr 2000. Betroffen sind vor allem die Systeme der Informationsverarbeitung, aber auch alle anderen technischen Anlagen.
Bei einem Finanzdienstleister werden darüber hinaus in besonderer Weise Aktiva und Passiva der Bilanz berührt. So muß zum einen das versicherungstechnische Exposure durch die Jahr-2000-Thematik abgeschätzt und beim Underwriting berücksichtigt werden. Zum anderen sind mögliche Auswirkungen der Jahr-2000-Thematik auf die Kapitalanlagen zu analysieren und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.
Weitere Aktivitäten betreffen die Information der Geschäftspartner einschließlich der Zusicherung der Jahr-2000-Festigkeit seitens wichtiger Lieferanten, die Beantwortung von Anfragen von Behörden und Geschäftspartnern, die Abklärung der juristischen Rahmenbedingungen sowie die Erarbeitung einer Notfallplanung.
Die Abschätzung des versicherungstechnischen Exposures durch das Jahr-2000-Problem wirft erhebliche Probleme auf und entzieht sich letztlich einer Quantifizierung. Gleichwohl gibt es Möglichkeiten der Exposurebegrenzung, wobei diese in den verschiedenen Märkten in unterschiedlichem Ausmaß genutzt werden.
In unserer vernetzten Gesellschaft ist Datenschutz zunehmend in Gefahr und
wird verstärkt zum internationalen Problem. Eine internationale Harmonisierung
der Datenschutzgesetzgebung ist jedoch aufgrund kultureller Unterschiede kaum
erreichbar. Daher wird von Datenschutzbeauftragten und vom deutschen
Gesetzesgeber verlangt werden, daß Datenschutz auch durch Technik durchgesetzt
werden muß. Dieser Beitrag soll einen Überblick zu Datenschutztechnologien
zum Schutze von Benutzern und Betroffenen geben. Zunächst werden
Datenschutztechnologien zum Schutze der Benutzeridentitäten betrachtet, welche
insbesondere Anonymität, Pseudonymität, Unbeobachtbarkeit für die Benutzer
gewährleisten können. Danach wird ein aufgabenbasiertes Datenschutzmodell
vorgestellt, welches in Form eines formalen Zustandsmaschinen-Modells definiert
wurde und speziell das Ziel hat, juristische Datenschutzforderungen technisch
durchzusetzen.
Es werden Denk- und Vorgehensweisen sowie generelle Zielsetzungen und
Fragestellungen betrachtet, und zwar unter folgenden Gesichtspunkten:
Theorie (Konzepte, Formalismen, Methoden),
Praxis (Ingenieurskunst, Anwendungen),
Mechanisierung (Hilfsmittel, Werkzeuge, ihre Konstruktion und Verwendung).
Während in der Mathematik die Theorie im Zentrum steht, ist es in der
Informatik die
Unterschiedliche Vorgehensweisen in der Informatik beruhen auf verschiedenen
Auffassungen vom Computer als
Die Kryptologie ist eine der Basiswissenschaften für die Informationsgesellschaft
im Zeitalter des Internet. Im Wortsinne beschäftigte sie sich zunächst mit der
Verschlüsselung von Texten bzw. Daten, seit der Entdeckung der Public Key
Kryptographie vor 30 Jahren aber auch mit komplexeren Anwendungen wie Digitalen
Signaturen, Digitalem Geld oder geheimen und fälschungssicheren demokratischen
Wahlen via Telekommunikation. Vor 30 Jhren wandelte sich damit die Kryptologie
von einer arkanen Wissenschaft im Umfeld der Geheimdienste in eine
Teildisziplin der Mathematik mit engen Verflechtungen zur Informatik, aber
neuerdings auch mit der (theoretischen) Entwicklung von DNA- und Quantencomputern
der Molekularbiologie und Physik.
Der Vortrag geht ein auf die Mathematischen Grundlagen der Public Key Systeme,
auf Infrastrukturen wie Trust Center, die zur Verwaltung solcher Systeme bei
massenhfter Anwendung notwendig sind, sowie auf rechtliche und politische
Probleme beim Aufbau dieser neuen Infrastrukturen.
Ausführliche Zusammenfassung im pdf-Format
Kryptologische Verfahren eignen sich für Lernsituationen sowohl im
Mathematikunterricht als auch im Informatikunterricht. Da ihnen noch immer ein
Geruch von Geheimdienst und Krimi anhaftet, sie andererseits wegen ihrer
Bedeutung für die Sicherheit von Datenübertragungen in einem öffentlichen Netz
hoch aktuell sind, geht von ihnen eine hohe Motivation aus. Je nach
Fachperspektive werden im Unterricht die Schwerpunkte unterschiedlich gesetzt.
Dabei stößt man im Mathematikunterricht ohne Computer genau so schnell an
Grenzen wie im Informatikunterricht ohne Mathematik.
Im Vortrag sollen Ideen für solche Lernsituationen in der Sekundarstufe I und
II vorgestellt werden. Jeweils wird betrachtet, welche Inhalte des betreffenden
Faches dabei erarbeitet oder geübt und welche Ziele damit verfolgt werden
können.
Datenschutz durch Technik
Dr. Simone Fischer-Hübner
Zum Gemeinsamen und Trennenden von Mathematik und Informatik
Prof.Dr.Dr.h.c. Wilfried Brauer
Mechanisierung/Automatisierung (mit Hilfe des Computers).
Kryptographie, Fragen der Zertifizierung, Datensicherheit aus dem
aktuellen Stand
Dr. Michael Hortmann
Kryptologie in der Schule
Monika Seiffert
Dr. Hubert Kiechle
Tue Oct 19 09:36:21 MEST 1999